In jedem Jahrzehnt seit Beginn des Kalten Krieges verfügte mindestens ein Nachrichtendienst eines NATO-Staates über eine hochrangige Innenquelle in – oder Überläufer aus – Moskaus Militärgeheimdienst. Trotz seiner Umbenennung 2010 in GU (Glawnoje Uprawlenije Generalnowo schtaba Wooruschjonnych Sil Rossijskoj Federazii/Hauptverwaltung des Generalstabes der Streitkräfte der Russischen Föderation) hält sich, auch in Russland, seine traditionelle Bezeichnung GRU (Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije/Hauptverwaltung für Aufklärung) bis heute. Der 2025 auf sein einhundertsiebenjähriges Bestehen zugehende Dienst war Vorbild für die militärischen Aufklärungsorgane der im 1955 gegründeten Warschauer Pakt (WP) vereinten Streitkräfte der sog. Ostblockstaaten, wenngleich nur die GRU global ausgerichtet war.
In einer Zeit, in der militärische Konflikte zwischen den beiden großen Blöcken NATO und WP mal mehr, mal weniger möglich erschienen, kam der GRU die Hauptaufgabe zu, so viele sicherheitspolitische und militärische Informationen wie möglich über potentiell gegnerische, vor allem natürlich westliche, Streitkräfte zu beschaffen. Unbestritten ist, dass sie – im Verbund mit ihren Bündnis- und anderen Partnerdiensten – diesen Auftrag auf erstaunlich hohem Grad für alle möglichen Kriegsschauplätze erfüllte. Das Mitte der achtziger Jahre in der DDR erschienene Buch Die Streitkräfte der NATO auf dem Territorium der BRD und später zugängliche Dokumente in Militärarchiven zeugen davon eindrucksvoll.
Weniger bekannt ist, dass es gerade hohe Offiziere der GRU waren, die dem Westen halfen, sicherheitspolitische und militärische Kognitionen der im Kreml Regierenden zu erkennen und zu verstehen. Auch die GRU hat ihre “eigene” Sprache, hier Auszüge aus einem GRU-Wörterbuch Russisch-Deutsch:
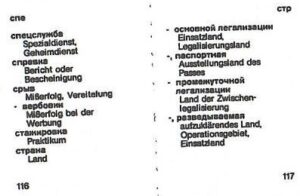
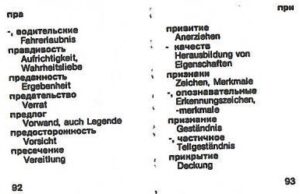
So war es Oberst Pjotr S. Popow, der in der frühen Phase des Kalten Krieges, den fünfziger Jahren, Washingtons noch junger Central Intelligence Agency Einblicke aus dem Inneren der GRU vermittelte. Von ihm erhielt der Westen Kenntnisse über die neue Aufstellung der sowjetischen Landstreitkräfte, Atom-Unterseeboote und Lenkflugkörper sowie Informationen über das als U-2 bekannte US-Aufklärungsflugzeug (die allerdings im wesentlichen vom KGB beschafft worden waren). Der Staatssicherheitsdienst hatte nach der Entdeckung von Popows Tätigkeit als Maulwurf versucht, ihn als Desinformationskanal gegen die CIA zu nutzen. Das Doppelspiel endete für Popow, den Uhl (S. 494) den „ersten CIA-Maulwurf in der GRU“ nennt, 1960 mit der Todesstrafe und seiner Hinrichtung.
Auf Popow folgte fast nahtlos der bis heute relativ bekannte Oleg W. Penkowski, auch er im Rang eines Oberst. Seine Zeit als aktive Quelle für CIA und den britischen SIS währte nicht einmal zwei Jahre. Aber in diese Monate fielen zwei Schlüsselmomente des Kalten Krieges mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 und der Kuba-Krise im Jahr darauf: Moskau wollte Mittelstreckenraketen, die mit nuklearen Sprengköpfen ausrüstbar waren, auf der Karibik-Insel stationieren. Sie hätten Ziele in einem Radius von bis zu 4.500 Kilometern erreichen können. Unter anderem U-2-Überflüge hatten die Raketenstellungen eindeutig bewiesen. Die USA reagierten mit einer Seeblockade.
In der Mitte dieses hoch riskanten Konflikts der Supermächte, am 22. Oktober 1962, wurde Penkowski verhaftet. Es ist bis heute nicht eindeutig belegt, seit wann das KGB von seiner Verbindung zu den US- und britischen Diensten wusste. Wenngleich – vielleicht auch weil? – das Gros des von Penkowski übermittelten Materials nach wie vor unter Verschluss gehalten wird, darf von einem großen Wert, den seine Innenkenntnisse aus Moskau für die Regierungen in Washington und London hatten, ausgegangen werden. 1963 wurde er hingerichtet.
Wenngleich nicht ganz so hochrangig, dafür aber mit exzellenten Zugängen zu Material von GRU-Quellen im Westen war Nikolaj D. Tschernow seit den sechziger Jahren aktiv. Aufgrund seiner Informationen wurden in NATO-Staaten sowjetische Agenten aufdeckt. Er trug maßgeblich zur sogenannten Affäre Jeanmarie bei: bis heute wird diskutiert, wie groß der Schaden des 1976 verhafteten Brigadiers Jean-Louis Jeanmaire für die Sicherheit der Schweiz tatsächlich war. Tschernows Informationen belegten deutlich, wie sehr Moskau den Alpenstaat dem westlichen Militärbündnis zurechnete und entsprechend aufklärte. Jahrzehnte später ging Peter Veleff, einstiger Generalsekretär der Militärdirektion des Kantons Zürich, dieser Frage intensiv nach.
Es ist bemerkenswert, dass Tschernow sich bereits 18 Jahre im Ruhestand und die UdSSR in Agonie befand, als er erst 1990 verhaftet, im Jahr darauf zu einer Haftstrafe verurteilt und bald darauf von Präsident Boris N. Jelzin begnadigt wurde.
Über den Dienstgrad Oberst hinaus sogar zum Generalmajor stieg Dmitri F. Poljakow auf. Seit Anfang der 1960er Jahre stand er in US-Diensten. Wem er eventuell (zugleich) noch diente, vielleicht als Doppel- oder sogar Dreifachagent, bleibt weiteren Forschungen vorbehalten. Von ihm erfuhr der Westen Interna über Moskaus Positionen gegenüber asiatischen Staaten, darunter die Volksrepublik China – in der Phase der diplomatischen Annährung Pekings an die USA – und Indien sowie Prioritäten der Ausbildung angehender GRU-Agenten für den Einsatz in Nordamerika. Außerdem brachte er Licht in Methoden, mit denen die GRU westliche Rüstungstechnik über Ausfuhrverbote hinweg zu beschaffen suchte. Das KGB kam auch Poljakow letztlich auf die Spur. 1988 wurde die gegen ihn verhängte Todesstrafe vollstreckt.
Am Sprung der sechziger zu den siebziger Jahren begann Wladimir B. Resun seine Laufbahn in der GRU. Sie führte ihn durch Verwendungen in der operativ-taktischen Aufklärung, den als SpezNas bekannten Spezialkräften bis in die sowjetische Legalresidentur bei den Vereinten Nationen in Genf. 1978 wechselte er die Seiten zum britischen SIS. Wie üblich hatten zunächst nur ausgewählte, kleinste Kreise westlicher Nachrichtendienstangehöriger und Bedarfsträger unmittelbaren Nutzen von Resuns Wissen. Noch im selben Jahr wechselte er auch physisch die Seiten, um fortan in Großbritannien zu leben und zu schreiben. GRU-Major Resun verdankte 1984 die breite interessierte Öffentlichkeit das damals fast schon einmalig zu nennende Buch Inside Soviet Military Intelligence, gefolgt von Inside the Aquarium: The Making of a Soviet Spy (der Titel spielt auf die Glasfassade des GRU-Hauptquartiers in Moskau an). Diese – und viele weitere Veröffentlichungen – erschienen unter dem Pseudonym Viktor Suvorov und sind heute noch lesenswert.
Die achtziger Jahre waren zunächst geprägt von einer weiteren Abkühlung im bipolaren Systemkonflikt. Der NATO-Doppelbeschluss brachte mit atomaren Sprengköpfen ausrüstbare Pershing II und Cruise Missiles nach Westeuropa, Moskau dislozierte SS-20 ‚Saber‘ im Osten. Während im Kreml binnen drei Jahren dreimal die Staats- bzw. Parteispitze wechselte (von Juri W. Andropow über Konstantin U. Tschernenko zu Michail S. Gorbatschow), erklärte US-Präsident Ronald W. Reagan im Rundfunk seinen „fellow Americans“: „I’m pleased to tell you today that I’ve signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes.” Es sollte ein Scherz gewesen sein. Eineinhalb Jahre zuvor hatte Reagan das Weltraumwaffenprogramm Strategic Defense Initiative (SDI) auf den Weg gebracht. Im September 1983 schoss ein sowjetischer Abfangjäger eine Boing 747 der Korean Air Lines südlich von Sachalin ab. Und nur neun Wochen später führte die NATO ihre Kommandostabsübung ‚Able Archer 83‘ so realitätsnah durch, dass in Moskau zeitweise von einem echten Angriff, oder zumindest seiner Vorbereitung, ausgegangen wurde.
Die wahrscheinlich tiefgehendsten Einblicke in die Wahrnehmung des Kreml dürften, nach heutigem Stand, auch von einem sowjetischen Nachrichtendienst-Oberst gekommen sein, allerdings nicht aus der GRU sondern vom KGB, dem im März dieses Jahres verstorbenen Oleg A. Gordijewski. Ihm verdankte der Westen auch Belege für die in Teilen der sowjetischen Führung tatsächlich vorhandene Annahme, der Westen würde einen nuklearen Überraschungsschlag ausführen können – und vielleicht sogar wollen. Schon unter Generalsekretär Andropow, der zuvor von 1967-82 KGB-Vorsitzender war, hatte das KGB das umfangreiche Aufklärungsprogramm RJaN begonnen, in das alle Ostblockdienste einbezogen wurden, auch – und das war ungewöhnlich – die Aufklärungsorganisationen der Streitkräfte wie Moskaus GRU und der Bereich Aufklärung der Nationalen Volksarmee der DDR.
Parallel ermöglichte in jenen Jahren GRU-Oberst Gennadi A. Smetanin dem Westen Erkenntnisse, wofür sich Moskau im südwestlichen Europa, besonders in Portugal, interessierte. Der Staat spielte eine wichtige Rolle in Verteidigungs- und Verlegeplanungen der NATO über den Atlantik sowie der Überwachung eines großen Teiles dieses Seeraumes. Mit Smetanins Festnahme endete für den Westen dieser Zugang 1986. Auch Smetanin wurde hingerichtet.
Derweil flossen Informationen über GRU-Quellen im Westen und ihre Führung aus Osteuropa heraus über den aus den Luftstreitkräften stammenden Wladimir Wasilijew, auch er im Dienstgrad eines Obersten. Das wenige, das über diese Innenquelle bekannt ist, stammt aus Uhls Werk (S. 549 f.). Auch Wasilijews Schicksal endete, 1986, mit der Festnahme, gefolgt von Todesurteil und Hinrichtung.
Der neben Penkowski medial vielleicht bekannteste GRU-Oberst konnte 1995 für den britischen SIS angeworben werden, Sergei W. Skripal. Seine Bekanntheit erlangte er außerhalb der ND-Community allerdings erst viele Jahre nach seiner Festnahme 2004 und seinem Austausch nach Großbritannien sechs Jahre darauf. Obwohl vom russischen Präsidenten Dmitri A. Medwedew begnadigt wurden Skripal und seine Tochter 2018 in seinem Wohnort Salisbury Ziel eines Giftstoffanschlags. Bis dahin hatte Skripal Nachrichten- und Abwehrdiensten mehrerer NATO-Staaten tiefe Einblicke in die GRU, ihre Ziele und Methoden sowie russische Spionageaktivitäten im Allgemeinen vermittelt.
Seine Laufbahn hatte ihn Ende der siebziger Jahre über die SpezNas-Kräfte (sie bildeten 1979 die Vorhut der sowjetischen Invasion Afghanistans) in den Militärgeheimdienst geführt. 1984 trat er seinen Dienst auf Malta an, dem militärisch äußerst bedeutsamen Inselstaat im Mittelmeer. Es folgte der Einsatz in Madrid. Spätestens nun begann Skripal sein Doppelspiel. 1996 in die Zentrale nach Moskau zurückberufen, vermochte er aufgrund seiner Positionen – er leitete zeitweise sogar eine Personalabteilung – wichtige Information über die Aufbauorganisation der GRU, strategische Ausrichtungen und ihre Arbeit gegen südeuropäische Mittelmeerstaaten zu übermitteln – in einer Zeit, in der die Sowjetunion aufgelöst wurde und Russland von der Ära Jelzin zur Ära Putin überging, einschließlich all der damit verbundenen sicherheitspolitischen und militärischen Veränderungen.
Natürlich arbeiteten nicht nur (diese) GRU-Offiziere als Innenquellen für die Dienste von NATO-Staaten oder liefen zu ihnen über. Von vielen anderen aus dem KGB und anderen WP-Diensten flossen über Jahrzehnte Interna in den Westen. Aus diesen Informationen konnten die NATO-Dienste Erkenntnisse erarbeiten, die ihren Bedarfsträgern ein besseres Verständnis der Wahrnehmung, des Denkens und des Planens der Herren im Kreml vermitteln konnten.
Es wäre also zu hoffen, dass auch jetzt, wo sich vielen Denken und Handeln der Kremlspitze kaum zu erschließen scheinen, Innenquellen in GRU, FSB, SWR und FSO dem Westen Einblicke ermöglichen, damit hier Annahmen über Moskaus mittel- und langfristige Interessen auf authentischer Grundlage er- und begründet werden können.
Einen potentiellen Gegner zu erkennen, ist schon gut – seine Absichten frühzeitig erkannt zu haben, ist besser.
Literaturauswahl
Jedem, der sich für die sowjetische und russische GRU/GU interessiert, ist unbedingt GRU. Die unbekannte Geschichte des sowjetisch-russischen Militärgeheimdienstes von 1918 bis heute (ISBN 978-3-534-61012-9) des Historikers Matthias Uhl zu empfehlen. Ihm ist die beste Darstellung dieses militärischen Aufklärungs- wie Geheimdienstes auf der Grundlage unzähliger Quellen aus Moskauer Archiven gelungen. Im Interview mit dem Bundeswehr Journal bezeichnete Uhl die GRU „als tragende Säule in der russischen Sicherheitsarchitektur“.
Zur Geschichte der Militäraufklärung bis 1941 – Alekseev, Michail: Voennaja razvedka Rossii, Moskau 1998, 2 Bd.
Nehring, Christopher: 100 Jahre GRU. Werdegang und Professionalität eines russischen Geheimdienstes, in: Russland-Analysen. Nr. 363, 11.12.2018, S. 8-11
Puschkin, Juri: GRU in Deutschland. Aktivitäten des sowjetischen Geheimdiensts nach der deutschen Wende, Düsseldorf 1992
Suworow (de)/Suvorov (en), Viktor: Inside Soviet Military Intelligence, London 1984
ders.: Aquarium. (Аквариум), London 1985
ders.: GRU – Die Speerspitze: Was der KGB für die Polit-Führung, ist die GRU für die Rote Armee, Düsseldorf 1988 bzw. für die 3. Auflage Solingen
Veleff, Peter: Angriffsziel Schweiz? Das operativ-strategische Denken im Warschauer-Vertrag mit Auswirkungen auf die neutralen Staaten Schweiz und Österreich, Zürich 2007
Zum Aufklärungsprogramm RJaN – Fischer, Benjamin B.: A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare, hrsg. v. Center for the Study of Intelligence der Central Intelligence Agency, Washington, D. C./Langley, Sept. 1997
Dr. Bodo Wegmann
Fachreferent für Sicherheitspolitik und geheime Nachrichtendienste, Mitglied im Vorstand des Gesprächskreis Nachrichtendienste in Deutschland e. V. (GKND). Er befasst sich u. a. mit nachrichtendienstlichen Aufbau- und Arbeitsorganisationen sowie weniger bekannten Diensten.

